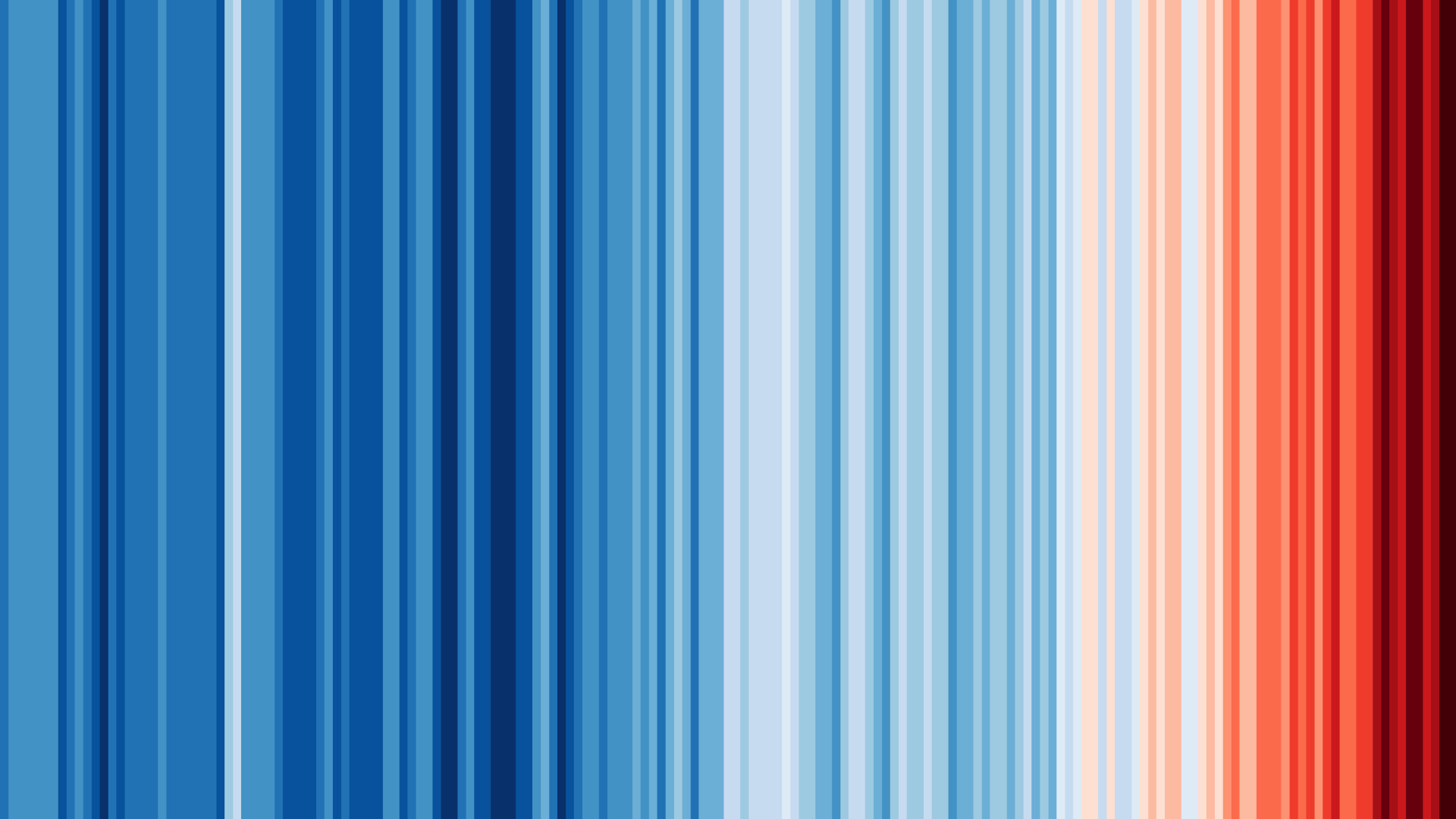EU 1.5° Lifestyles: Nachhaltige Lebensstile ermöglichen durch strukturellen Wandel
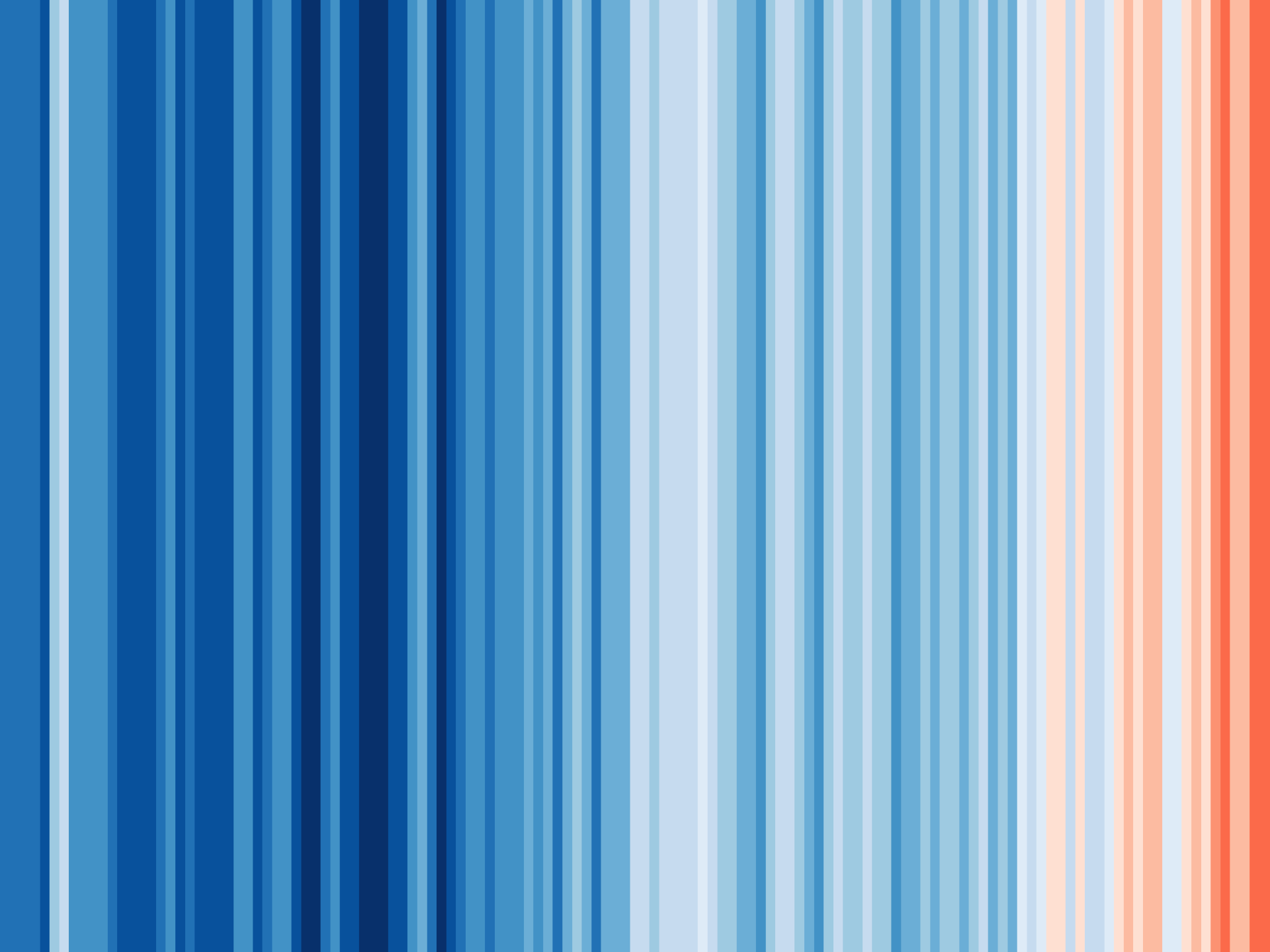
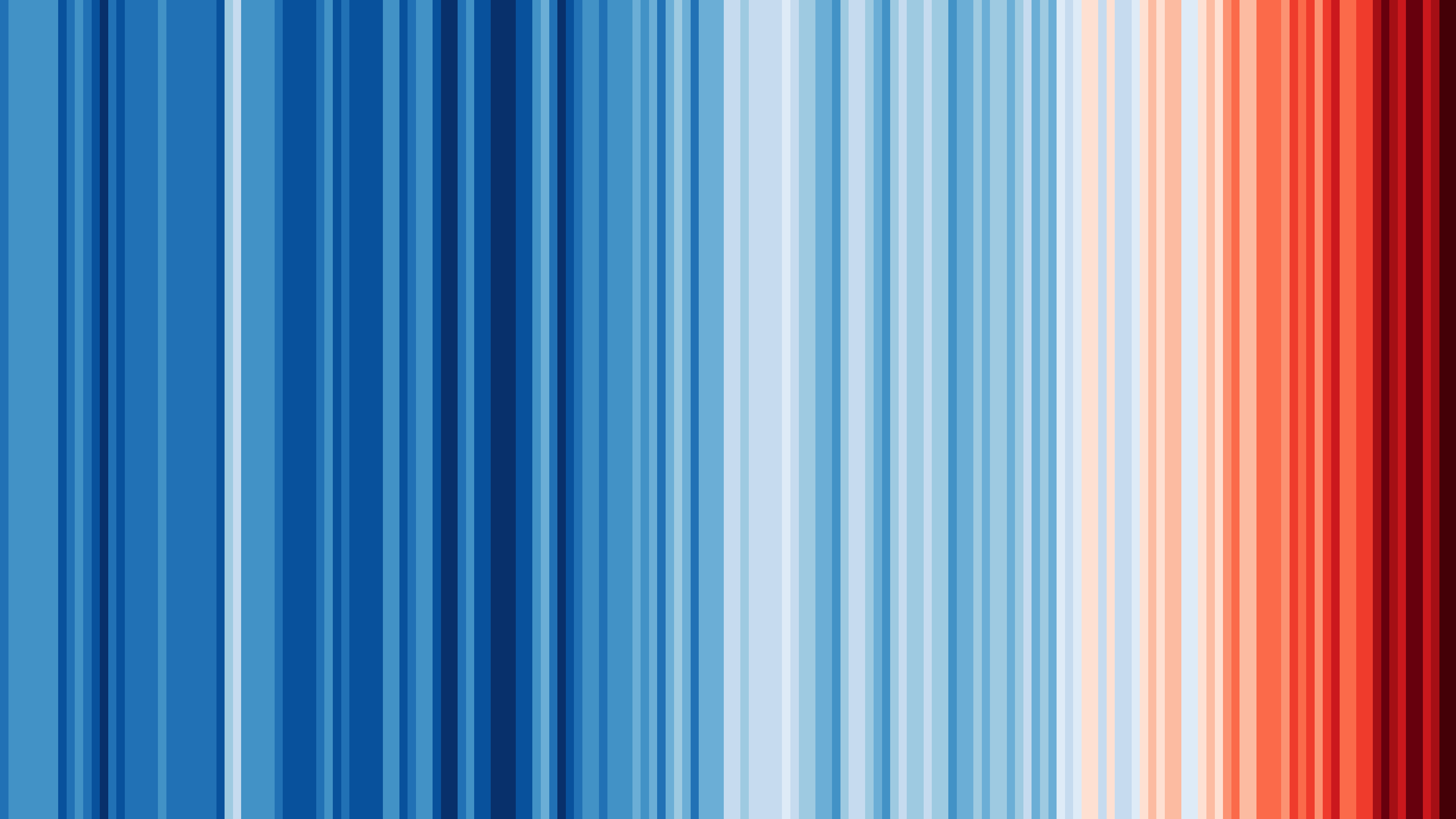
Um möglichst nah am 1,5°-Ziel zu bleiben, sind erhebliche Emissionsminderungen nötig. Durch technologische Innovation allein sind diese nicht zu erreichen. Das EU-geförderte Projekt EU 1.5° Lifestyles erforschte daher unter der Leitung des RIFS den notwendigen Wandel von Lebensstilen und dessen strukturelle Voraussetzungen.
Ausgehend von Projektionen zur Dekarbonisierung hat das Forschungsprojekt EU 1.5° Lifestyles belegt, dass technologische Lösungen allein nicht ausreichen, um in der Nähe des 1.5°C-Ziels zu bleiben. Unverzichtbar sind Lebensstilveränderungen in allen zentralen Konsumbereichen: Mobilität, Ernährung, Wohnen und Freizeit. Dies betrifft insbesondere Maßnahmen mit einem hohen Potenzial zur Emissionsreduktion.
Bei der Erforschung von Lebensstilen geht es nicht allein um individuelle Vorlieben oder Appelle an das „grüne Gewissen“ von Konsument:innen. Vielmehr muss in den Blick genommen werden, wie alltägliche Konsumentscheidungen in ökonomische und gesellschaftliche Strukturen eingebettet sind. Diese bilden den Rahmen dafür, welche Produkte angeboten werden, wie diese hergestellt wurden und ob und wie sie konsumiert werden. EU 1.5° Lifestyles hat daher auf der Basis von quantitativen und qualitativen Analysen sowie ko-kreativen Formaten mit Bürger:innen und Stakeholdern die strukturellen Hürden erforscht, die den Wandel von Lebensstilen verhindern.


Die Ergebnisse zeigen, dass vor allem die mangelnde Differenzierung zwischen Bedarfen für Wachstum und Stabilität in ökonomischen wie gesellschaftlichen Bereichen einerseits sowie Bedarfen für Rückbau in diesen andererseits eine zentrale Barriere für eine effektive Transformation darstellt. Der politische Einfluss von Partikularinteressen, die vom nicht-nachhaltigen Status quo profitieren, ist ein damit verbundenes relevantes Problem, das sich etwa im Fortbestehen umweltschädlicher Subventionen zeigt. Die unter anderem aus diesem Einfluss resultierende Inkohärenz und Schwäche politischer Maßnahmen sowie die weiter bestehenden Möglichkeiten, soziale und ökologische Kosten auf die Gesellschaft umzulegen, während die Gewinne privatisiert werden, verhindern einen erforderlichen Wandel. Die Macht dieser strukturellen Hürden findet letztlich Ausdruck im Versagen von Politik und Gesellschaft, unsere Konsum- und Versorgungssysteme substanziell nachhaltiger zu gestalten, obwohl konkrete Veränderungspotenziale seit langem bekannt sind.
Nur mit dem Wissen über diese Hürden und ihre gezielte Adressierung besteht eine Chance, tatsächlich eine nachhaltige Zukunft zu gestalten. Das erfordert zum einen, Nachhaltigkeitsstrategien grundsätzlich mit einer Gerechtigkeitsperspektive zu verbinden – auch um populistischen Strategien entgegenzuwirken, die soziale und ökologische Zielsetzungen gegeneinander ausspielen. Zum anderen ist es nötig aufzuzeigen, welche Potenziale für das gesundheitliche und gesellschaftliche Wohlergehen nachhaltige Lebensstile und -strukturen bieten. Mandatierte Bürger:innenräte können gleichzeitig das politische Ungleichgewicht adressieren und eine Basis für einen neuen ökologisch-sozialen Gesellschaftsvertrag schaffen, der uns die Freiheit gewährt, gemeinsam, demokratisch und sozial gerecht Klima- und andere Nachhaltigkeitsziele zu verfolgen.